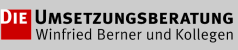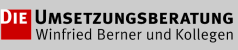|
Das ist eine wirklich neue Perspektive: Zuhören, nicht um zu verstehen, sondern um die Qualität des Denkens des Sprechenden zu verbessern. Nancy Kline erklärt, wie dies geht – und Manager, die es ausprobiert haben, bestätigen, dass es funktioniert.
Ausgangspunkt der Autorin – über die das Buch erstaunlich wenig verrät – ist eine Feststellung, der man kaum widersprechen kann: "Everything we do depends for its quality on the thinking we do first." (S. 15) Wenn man diese Prämisse aber akzeptiert, dann ist die Frage, wie sich die Qualität unseres Denkens verbessern lässt, in der Tat eine Frage von größter Bedeutung – nicht nur für Unternehmen, auch für unser Privatleben und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. – über die das Buch erstaunlich wenig verrät – ist eine Feststellung, der man kaum widersprechen kann: "Everything we do depends for its quality on the thinking we do first." (S. 15) Wenn man diese Prämisse aber akzeptiert, dann ist die Frage, wie sich die Qualität unseres Denkens verbessern lässt, in der Tat eine Frage von größter Bedeutung – nicht nur für Unternehmen, auch für unser Privatleben und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.
Die Qualität des Denkens fußt auf der Qualität des Zuhörens
Den zentralen Schlüssel zu dieser Qualitätsverbesserung sieht Nancy Kline nicht in irgendwelchen neuen Denkmethoden oder Denktechniken à la Edward de Bono, sondern – auf den ersten Blick etwas überraschend – in der Qualität des Zuhörens. Auf den zweiten Blick ist es, wenn wir unseren eigenen Erfahrungen nachhorchen, ein Zusammenhang zwischen der Qualität des Zuhörens und der Qualität unserer Gedanken gar nicht unplausibel: Wenn man uns kaum zuhört, stehen wir unter dem Druck, unsere Gedanken in jenes winzige Zeitfenster zu pressen, für das die Aufmerksamkeit unserer (Nicht-)Zuhörer gerade noch reicht.
Wenn uns der oder die Zuhörer dagegen Raum geben, uns ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und uns ermutigen, unsere Gedanken zu entfalten, kommt tatsächlich mehr dabei heraus – quantitativ, aber auch qualitativ. Entgegen möglichen Befürchtungen führt dies nicht zu endlosen Monologen: "Knowing they won't be interrupted frees people to think faster and say less." (S. 102)
Trotzdem ist es überraschend zu lesen: „When someone in your presence is trying to think, much of what you are hearing and seeing is your effect on them.“ (S. 16) Wenn das stimmen sollte, wäre es beeindruckend, aber auch anstrengend. Denn dann hätte man auf einmal eine Mitverantwortung für die Qualität der Gedanken seiner Gesprächspartner und könnte sich nicht mehr darauf zurückziehen, bei manchen Personen lohne es sich nicht, genau zuzuhören, weil sie ohnehin nur Stereotype nachplappern und keine substanziellen eigenen Gedanken haben. Was, wenn das gar keine Eigenschaft des Gesprächspartners wäre, sondern unser Echo?
"Everything we do depends for its quality on the thinking we do first"
Das ist ein starker Satz – einer, zu dem man im Ruhrgebiet sagen würde: "Da fällt dir nix mehr zu ein." Was natürlich das genaue Gegenteil von dem wäre, was Nancy Kline mit ihrem "Thinking Environment" erreichen möchte (und erreicht).
Ihr Buch enthält etliche solche Sätze, die sich nicht nur als Bereicherung jeder Zitatensammlung anbieten (in die meine sind sie bereits eingegangen), sondern dazu anregen, mit ganz neuen Augen auf unser Denken zu schauen und es als einen sozialen Akt zu begreifen: Danach bestimmen nicht allein die geistigen Fähigkeiten des Denkenden die Qualität des Gedachten, vielmehr beeinflusst das Verhalten die Gesprächspartner dessen Qualität in ganz erstaunlicher Weise. Sie können sie substanziell fördern, wenn sie nicht den Fehler machen, den Gedankenfluss mit Ungeduld, Geschwätzigkeit, Besserwisserei, unnötigen "Hilfen" und Geltungsbedürfnis zu stören oder gar ganz abzuwürgen.
Was man dafür tun muss, ist einfach und schwer zugleich: Zuhören. Die Klappe halten. Dem Sprechenden seine ungeteilte (!) Aufmerksamkeit widmen. Und wenn er (endlich) aufhört zu reden, nicht etwa zum lang ersehnten rhetorischen Gegenschlag ausholen, sondern ihn zum Weiterreden und zum Weiterdenken zu ermutigen. Wie? Am besten mit Schweigen, Nicken, Geduld und weiterhin ungeteilter Aufmerksamkeit, die die Stille nicht als das Ende der Äußerung missversteht, sondern als Denk-Pause:
"The fact that people have stopped speaking does not mean that they have stopped thinking." (S. 51)
Ein Ermutigungsbuch
Dieses Zuhören mit ungeteilter Aufmerksamkeit dient – anders als die nondirektive Gesprächsführung und ihre zahlreichen Abkömmlinge – nicht primär dem Verstehen und auch nicht dem Sich-Verstanden-Fühlen; es dient, auch wenn dieser Begriff bei Kline keine so zentrale Stellung hat, der Ermutigung der Sprechenden "to think for themselves", wie sie es immer wieder nennt. Also frei übersetzt eine Ermutigung dazu, ihren eigenen Kopf zu benutzen.
Insofern ist "Time to Think" ein ausgesprochen wichtiges und wertvolles Ermutigungsbuch – und eines, das den Nutzen von Ermutigung unmittelbar erlebbar macht. Ihre eingestreuten Fallbeispiele machen hautnah erlebbar, wie Ermutigung wirkt, wie sie unmittelbar den Denkprozess fördert und die Qualität seiner Gedanken Impuls für Impuls auf eine neue Stufe führt. Man kann förmlich dabei zuschauen, wie der Denkende mutiger wird – und man erlebt, welch bemerkenswerte Ermutigung schon der scheinbar banale konsequente Verzicht auf Unterbrechungen und schlaue Kommentare sein kann.
Limitierende Annahmen und präzise Fragen
Trotzdem gibt es manchmal einen Punkt, an dem die Denkenden nicht mehr weiterkommen – meist, weil irgendeine Annahme oder Befürchtung sie blockiert. In diesen Fällen reicht ungeteilte Aufmerksamkeit alleine nicht aus, um die Blockade zu lösen. Für diese Fälle hält Nancy Kline zusätzliche Instrumente parat, insbesondere die Identifikation blockierender Annahmen und ihre "punktgenauen Fragen" ("incisive questions" – wörtlich "einschneidende Fragen" – ich wäre neugierig, wie dies in der deutschen Ausgabe übersetzt wurde). Beide gehen sowohl in ihrem Denkansatz als auch in ihrer Präzision weit über das hinaus, was anderswo unter der Überschrift Gesprächsführung gelehrt wird.)
Wenn jemand gedanklich an einem bestimmten Punkt feststeckt und nicht mehr weiterkommt, liegt das nach Klines Erfahrung meist daran, dass er, ohne sich dessen voll bewusst zu sein, irgendwelche "limiting assumptions" macht. Genau nach diesen einengenden Annahmen fragt sie daher – und zwar auf äußerst behutsame Weise: "What might you be assuming that is stopping you from …?" (S. 54) Und zu meinem leisen Erstaunen sind offenbar die allermeisten Adressaten nach kurzem Zögern dazu in der Lage, tatsächlich eine limitierende Annahme zu benennen – wie etwa, dass andere sie für dumm halten könnten oder dass sie sowieso nichts bewirken können.
Die "Incisive Question" überwindet diese Annahme mit chirurgischer Präzision, wobei sie genau die Formulierung des Denkenden aufgreift und die "limiting assumption" dabei durch eine "freeing assumption" ersetzt: "Wenn du wüsstest, dass du etwas bewirken kannst, was würdest du tun?" Das klingt einfach, aber es verlangt, dass man sehr genau hinhört, die einengende Annahme erkennt (was eher analytisches als empathisches Zuhören voraussetzt) und sie punktgenau durch eine befreiende ersetzt. Kline fordert sogar, dass man dafür nicht seine eigenen Worte verwendet, sondern möglichst nah bei der Wortwahl des Denkenden bleibt.
Diese Frage stellt man als Denkpartner nicht nur einmal, sondern mehrfach – und regt damit immer neue Gedanken, Ideen und Ansatzpunkte an. Das geht so weiter, bis der Denkende irgendwann signalisiert: Jetzt ist es gut, jetzt fällt mir nichts Neues mehr ein, jetzt sind meine Gedanken wirklich ausgeschöpft.
Nach dieser íntensiven Erfahrung mit der punktgenauen Frage könnte man meinen, dass diese Frage dem Denkenden für immer in sein Gehirn eingebrannt ist – oder dass er sie doch zumindest glasklar präsent hat. Erstaunlicherweise ist das genaue Gegenteil der Fall: Schon unmittelbar danach können sich die Denkenden nach Klines Erfahrung kaum noch an deren Wortlauf erinnern. Da diese Frage aber das Potenzial hat, auch später noch weitere wertvolle Gedanken anzustoßen, empfiehlt sie ihnen dringend, sie sich aufzuschreiben.
Das Gespräch endet, indem sich der Denkende und sein Denkpartner wechselseitig ihrer Wertschätzung versichern. Was, wie Nancy Kline glaubhaft versichert, nicht bloß ein Psycho-Ritual ist, sondern beiden Partnern hilft, für sich einen guten Abschluss ihrer Zusammenarbeit zu finden. Denn sonst grübelt der Denkende möglicherweise nachträglich darüber nach, was sein Denkpartner wohl von seinen komischen Gedanken und seinen seltsamen Annahmen hält – und der Denkpartner sinniert, ob er alles richtig gemacht hat und ein guter Denkpartner war.
Ein "Thinking Environment" schaffen
Damit sich solche überaus einseitigen, aber auch überaus fruchtbaren Gespräche entfalten können, ist natürlich eine spezielle Atmosphäre erforderlich – eine, die Kline ein "Thinking Environment" nennt. Wer sich je mit Ermutigung und ermutigender Führung befasst hat, wird in dessen "Bauelementen" unschwer ein ermutigendes Klima erkennen. Hier die zehn "Components", die Kline fordert:
- "Attention. Listening with respect, interest and fascination.
- Incisive Questions. Removing assumptions that limit ideas.
- Equality. Treating each other as thinking peers.
- Appreciation. Practising a five-ot-one ratio of appreciation to criticism.
- Ease. Offering freedom from rush or urgency.
- Encouragement. Moving beyond competition.
- Feelings. Allowing sufficient emotional release to restore thinking.
- Information. Providing a full and accurate picture of reality.
- Place. Creating a physical environment that says back to people, 'You matter'.
- Diversity. Adding quality because of the difference between us." (S. 35)
Das sind (natürlich) nicht exakt die gleichen Worte, wie sie etwa Altmeister Theo Schoenaker verwendet, um ein ermutigendes Klima und speziell die indirekte Ermutigung beschreibt, aber es ist derselbe Geist.
Doch ein solches Thinking Environment kann nicht nur Einzelnen helfen, sich über eine bestimmte Fragestellung klarzuwerden, es kann auch einem Team – gleich ob einer Familie oder einem Konzernvorstand – helfen, die aktuelle Situation gemeinsam zu durchdenken oder kritische Themen zu bearbeiten. Das Grundprinzip bleibt auch in der Gruppe gleich: Aufmerksames Zuhören ohne Unterbrechungen, bis jemand seine Überlegungen zuende gebracht hat. Dann kommt reihum der nächste an die Reihe.
Nachdrückliche Empfehlung
Der vorhersehbare Manager-Einwand, das sei alles schön und recht, dauere aber für praktische Zwecke viel zu lange, lässt sich mühelos mit dem klassischen Gegenargument aus dem Qualitätsmanagement kontern: Wir haben nie die Zeit, etwas zuende zu denken, aber wir haben immer genug Zeit, um die Probleme in den Griff zu bekommen, die wir uns mit unserem halbgaren Denken eingebrockt haben.
Nachdem Nancy Kline im ersten Teil ihres Buchs die Grundprinzipien erklärt hat, ist Teil II der "Thinking Organization" sowie der "Thinking Partnership" gewidmet. In Teil III geht es um die "Thinking Society", und in Teil IV reißt sie kurz "A Thinking Future" an. Diese Ausweitung ist wohl auch von der Neigung vieler Autoren geprägt, ihre große Idee als Universalheilmittel für alle Menschheitsprobleme zu empfehlen. Auf der anderen Seite gilt ihre Prämisse: Wenn es zutrifft, dass die Qualität all unseres Handelns von der Qualität unseres Denkens abhängt, dann kann es nicht verkehrt sein, eine höhere Qualität des Denkens in unseren Beziehungen, Organisationen, in der Gesellschaft und in unserer Politik (ja, bitte!!) anzustreben.
Insgesamt eine Top-Empfehlung. Denn Nancy Kline käut in "Time to Think" nicht die altbekannten Aussagen über einfühlsames Zuhören, Paraphrasieren etc. wieder, sondern hat substanziell Neues zu sagen. Nämlich, dass es für die Qualität des Denkens gerade nicht primär auf Empathie, Verstehen und Sich-Verstanden-Fühlen ankommt, sondern darauf, den Denkenden durch ungeteilte Aufmerksamkeit und wenige, aber sehr punktgenaue Impulse zum eigenständigen Denken und zur Überwindung limitierender Annahmen zu ermutigen.
Das macht die altbewährten Grundsätze, die wir aus der nondirektiven Gesprächstherapie gelernt haben, nicht falsch oder hinfällig, zeigt aber ihre Begrenzung. Natürlich gibt es Situationen, in denen es vor allem darauf ankommt, dass jemand sich verstanden fühlt und seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmt. Für diese Zwecke ist eine erweiterte "verstehensorientierte" Gesprächsführung wohl weiterhin das Instrument der Wahl. Wenn es aber darum geht, gedanklich weiterzukommen und gedankliche Blockaden (limiting assumptions) zu überwinden, stellt uns Kline ein neues und in meinen Augen deutlich besser geeignetes Instrument zu Verfügung.
|