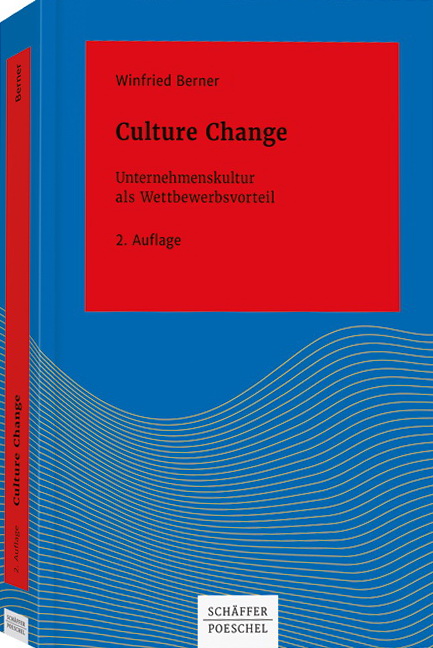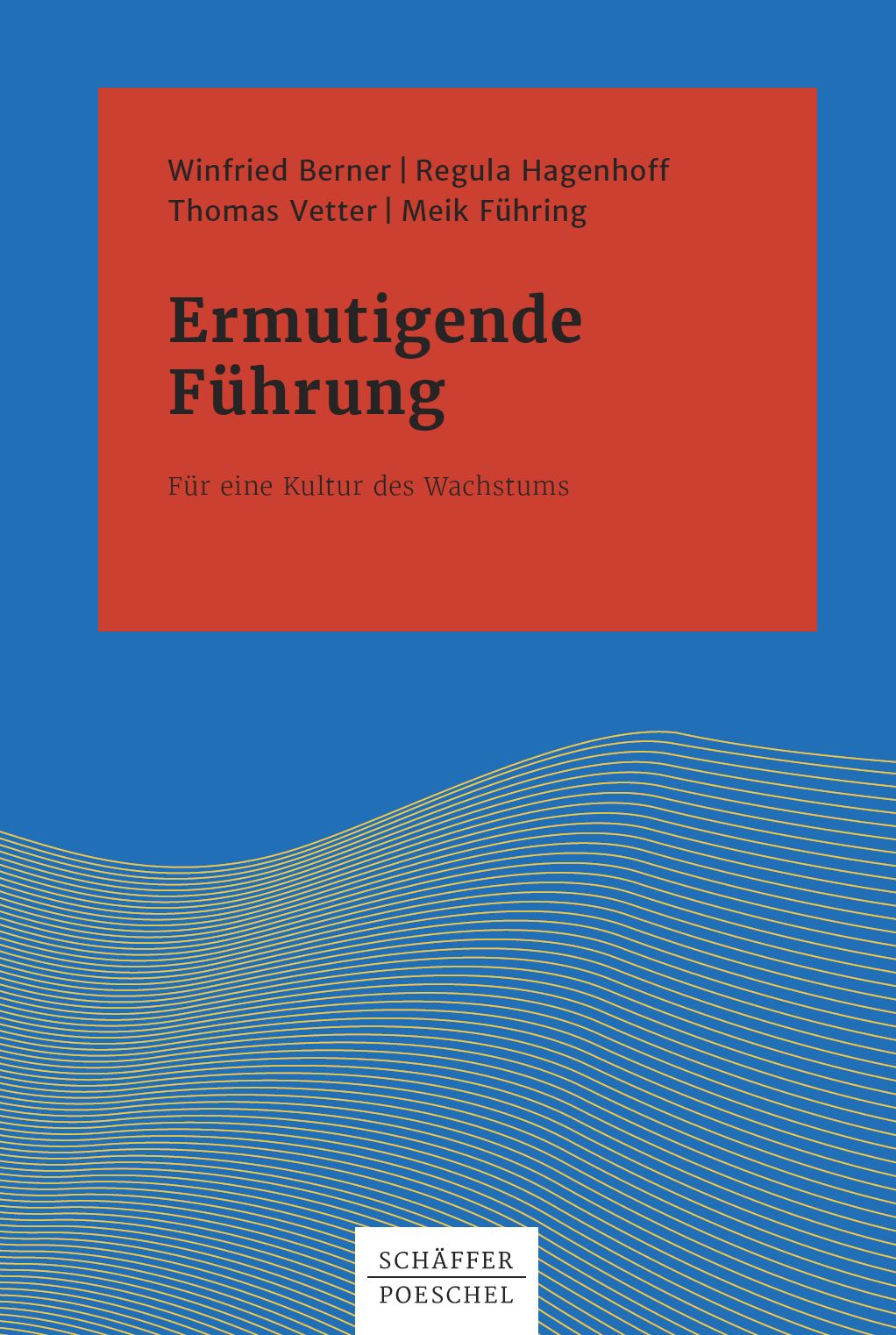Fallstudien und Projektbeispiele
|
||||||||||||||||
PMI-Nacharbeit: Gegen strukturelle Konflikte hilft kein Teambuilding (Fallstudie) |
||
|
Zwei Jahre nach der Übernahme eines britisch-amerikanischen Wettbewerbers war ein Unternehmen der Metallbranche faktisch immer noch zweigeteilt: Der deutsche und der angelsächsische Teil der Firma führten einen erbitterten Kleinkrieg um praktisch alles, worüber sich zu streiten lohnte: Um die Zuordnung von Aufträgen und Komponenten, um Standards und Normen, um interne Spielregeln und Freiheitsgrade ... Zwei vorausgegangene Integrations-Workshops waren dank pfiffiger Gestaltung sehr gut gelaufen, hatten aber keinen Durchbruch im Tagesgeschäft gebracht. Die Manager hatten sich ausgezeichnet verstanden und viel Spaß miteinander gehabt, doch die erhoffte Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Standorten war leider ausgeblieben. |
||
|
Der Personalchef war immer noch begeistert: Die beiden vorausgegangenen Integrations-Workshops waren sehr gut angekommen. Beim letzten Mal war die Veranstaltung als "Großes Pow-Wow" inszeniert worden: Die teilnehmenden Manager hatten sich, als Indianer geschminkt, in einem großen Zelt versammelt, sich dort die Geschichten ihrer "Stämme" erzählt und sich gegenseitig symbolische Geschenke übergeben; am Schluss hätten sie die Friedenspfeife geraucht, und die Geschäftsführer hätten feierlich Blutsbrüderschaft geschlossen. Ein Outdoor-Teil am folgenden Tag habe dann alle praktisch erleben lassen, dass Kooperation erfolgreicher ist als Rivalität und Einzelkämpfertum. Nach diesen zwei Tagen seien die Teilnehmer tief beeindruckt und bewegt auseinandergegangen; die Geschäftsführung sei begeistert gewesen. Für die Folgeveranstaltung müsse man sich daher wirklich etwas einfallen lassen, um die vorausgegangenen zu toppen. |
|
|
"Die Konflikte sind geblieben" |
||
|
Auf die Frage, warum er dann nicht mit jener Agentur weiterarbeite, die diese beiden so erfolgreichen Veranstaltungen konzipiert und moderiert hatte, meinte der Personalchef, die Geschäftsführung sei der Meinung, man müsse diesmal pragmatischer an die Sache herangehen. Was das heiße? Die Veranstaltungen seien nach Auffassung der Geschäftsführung und auch nach seiner eigenen zwar ein großer Erfolg gewesen und hätten dazu beigetragen, das persönliche Verhältnis zwischen den beiden Seiten zu entkrampfen, doch die Konflikte zwischen den Standorten seien geblieben. Ja, um ehrlich zu sein, sie seien sogar noch heftiger geworden, mit der Folge, dass auch einige der Manager, die sich bei den Workshops noch prächtig verstanden hatten, mittlerweile so sehr zerstritten seien, dass sie sich weigerten, miteinander zu reden. Stattdessen würden sie sich, wo es ging, gegenseitig über den Tisch ziehen – worauf die jeweils Düpierten sich wütend bei der Geschäftsführung beschwerten und sie zur Intervention aufriefen. Was sie nicht hinderte, selbst bei nächster Gelegenheit ähnlich zu agieren. |
|
|
|
Worüber denn da so erbittert gestritten wurde? Im Wesentlichen über die Frage, an welchen Standorten welche Aufträge produziert werden sollten. Theoretisch gab es zwar Regeln, welche Teile und Maschinen in welchen Standorten hergestellt werden sollten, und diese Regeln waren so klar, wie sie unter den gegebenen Umständen sein konnten. Sie sahen eine Spezialisierung der Standorte auf bestimmte Maschinentypen vor, um auf diese Weise Erfahrungs- und damit Kostenvorteile aufzubauen. Praktisch war jedoch jeder Standort dazu in der Lage, fast das gesamte Produktspektrum des Unternehmens zu herzustellen, und natürlich war jeder Standort davon überzeugt, auch das gesamte Programm (mindestens) so effizient wie die anderen produzieren zu können. Dass die Controlling-Zahlen eine andere Sprache sprachen, wurde von den jeweils besseren Standorten als objektiver Nachweis ihrer Überlegenheit interpretiert, von sämtlichen anderen als "politisch gewollte" Darstellung zurückgewiesen. |
|
|
|
Was den Konflikt verschärfte, war, dass die Kapazitäten des Unternehmens erstens nicht voll ausgelastet waren und dass zweitens der Auftragseingang zwischen den Produktgruppen erheblich fluktuierte. Es konnte also vorkommen, dass an einem Standort Überstunden gemacht wurden, während an einem anderen Kurzarbeit herrschte und sogar Personal abgebaut werden musste – und es kam vor. Die Geschäftsführung begründete diese rigide Politik damit, dass es anderenfalls niemals gelingen werde, in dem Unternehmen eine Spezialisierung der Standorte durchzusetzen. Eine Zuteilung, die für einen Ausgleich unterschiedlicher Auslastungen sorgen würde, würde Tür und Tor dafür öffnen, dass am Ende jeder Standort wieder das gesamte Spektrum produzierte. |
|
|
Ängste und "Vorneverteidigung" |
||
|
Infolgedessen gab es an allen Standorten, die jemals von solchen Auslastungsschwankungen betroffen gewesen waren, massive Ängste. Sie bewegten nicht nur die Mitarbeiter und Betriebsräte, sondern hatten auch die dortigen Manager erfasst. Dazu kam, dass sich sowohl an dem britischen als auch dem amerikanischen Standort hartnäckig Gerüchte hielten, die – mehrheitlich deutsche – Geschäftsführung habe längst die Schließung ihres Standorts beschlossen und warte nur noch auf einen Vorwand, etwa auf eine besonders niedrigen Auslastung, um ihre Absicht plausibel begründen und in die Tat umsetzen zu können. An den deutschen Standorten gab es diese Befürchtung nicht, dafür herrschte dort die Wahrnehmung vor, die beiden "angeheirateten" Standorte in England und den USA hätten sich gegen die Deutschen verbündet und würden sie mit unfairen Mitteln übervorteilen, obwohl doch eigentlich sie das übernehmende Unternehmen seien und daher den Ton angeben müssten. |
|
|
|
Das hatte dazu geführt, dass die Standorte untereinander sowohl offen als auch verdeckt um Aufträge kämpften, und zwar buchstäblich mit allen Mitteln. Während sie sich mit Worten zu der von der Geschäftsführung vorgegebenen Standortspezialisierung bekannten, taten die meisten oberen und mittleren Manager alles, um eingehende Aufträge dem Standort zuzuschanzen, dem sie sich am meisten verbunden fühlten. So pflegten sie enge Beziehungen zu "ihren" Vertriebsmitarbeitern und versuchten, den Vertrieb in "neutralen Ländern" auf ihre Seite zu ziehen. Manche Vertriebsmitarbeiter wiederum überredeten die staunenden Kunden, die Produktbezeichnungen in ihren Aufträgen so zu formulieren, dass sie vordergründig so aussahen, als würden sie in die Zuständigkeit des jeweils bevorzugten Standorts fallen. Und alle bemühten sich, unter der Hand vollendete Tatsachen zu schaffen, bevor die weltweite Auftragskoordination überhaupt die Chance hatte, einen Auftrag dem dafür eigentlich zuständigen Standort zuzuweisen. Weil sie Angst hatten, dass sie bei künftigen Aufträgen benachteiligt werden könnten, neigten außerdem alle dazu, Aufträge zu "bunkern", selbst wenn dies zu Lieferverzögerungen und Überstunden führte – und anderenorts natürlich die Auslastungsprobleme verstärkte. |
|
|
Die Geschäftsführung hatte in dieser Angelegenheit nicht immer glücklich agiert. Sie hatte die Sache großteils geschehen lassen, in einzelnen Fällen aber eingegriffen und attraktive neue Aufträge sozusagen "zur Strafe" anderen Standorten zugewiesen, wenn ein Standort sich davor auf allzu offensichtliche Weise bedient hatte. Genau wie bei Rivalitäten zwischen Geschwistern führte das jedoch nicht zu einer Befriedung, sondern auf der einen Seite zu Triumphgeschrei, auf der anderen Seite zu blanker Wut, weil die Eingriffe als ungerecht und hochgradig einseitig wahrgenommen wurden. Umso erbitterter wurde daher gestritten und getrickst, wenn die Geschäftsführung nicht hinschaute. |
||
Einen Weg zur Lösung entwerfen |
||
Schon diese erste Situationsanalyse ließ ahnen, dass kein Integrationsworkshop der Welt die vorhandenen Konflikte würde beseitigen können. Und dass es ebenso unsinnig wie unwürdig wäre, eine Veranstaltung voller Teambuilding und vordergründiger Harmonie zu inszenieren, wenn alle wüssten, dass das Hauen und Stechen am darauffolgenden Montag weitergehen würde. Denn die zum Teil hoch eskalierten Konflikte resultierten ja nicht aus persönlichen Animositäten, sondern aus Interessenkonflikten. Die ersten Workshops hatten ja gezeigt – und dazu beigetragen –, dass die Manager persönlich durchaus miteinander konnten. |
||
Andererseits ist es typisch für solche strukturellen Konflikte, dass sie früher oder später personalisiert werden: Auch wenn es zunächst die Strukturen sind, die die Manager in eine Gegenposition zueinander bringen, kämpfen sie ja nicht gegen abstrakte Strukturen, sondern gegen reale Menschen. Früher oder später fangen sie daher auch an, übelzunehmen, verletzt zu sein oder Rachegefühle zu hegen. Spätestens dann ist aus dem strukturellen Konflikt eine Feindschaft zwischen Personen geworden. (Was nicht heißt, dass die Sache damit unrettbar verloren ist, aber doch, dass sie sich verkompliziert hat.) |
||
Wie müsste in dieser Situation ein Management-Workshop aussehen, der wirklich weiterhilft? Oder, allgemeiner gefragt, was hilft in solch einer Situation überhaupt weiter? Ist ein Workshop hier das geeignete Mittel? Prinzipiell ist immer Skepsis angebracht, wenn das Format – Management-Workshop – bereits feststeht und die Aufgabenstellung damit unausgesprochen lautet, den Inhalt an das Format anzupassen. Damit kann man Glück haben, wenn das Format "zufällig" zu dem passt, was inhaltlich geschehen muss; man kann aber auch Pech haben und durch die Vorfestlegung in ein Format gezwungen sein, das sich ausgesprochen schlecht dafür eignet, die von der Sache her sinnvollen nächsten Schritte zu machen. Deshalb empfiehlt es sich, sein Denken nicht in das Korsett des vordefinierten Formats zu zwängen, sondern zunächst einmal inhaltlich Klarheit darüber zu gewinnen, was in der gegebenen Situation nützlich wäre, die Situation zu verbessern, und erst dann zu schauen, ob sich das vorgegebene Format für diesen Zweck eignet. Wenn ja, kann man es natürlich nehmen – wenn nicht, ist es im Zweifel besser, einen bereits angesetzten Workshop abzusagen, als, ihn um jeden Preis durchzuführen und ihn dann vor die Wand zu fahren. |
||
Die dringlichste Frage war daher, was zur Entschärfung des vorhandenen Konflikts geschehen müsste – und wie er in einem ersten Schritt so weit eingedämmt werden könnte, dass er zumindest nicht weiter eskalierte. Um das zu beantworten, war es erforderlich, die Konfliktdynamik noch etwas genauer zu verstehen. Standortkonflikte gibt es ja überall, wo es konkurrierende Standorte gibt, also Standorte, die die gleichen Produkte herstellen – oder auch dazu zunindest prinzipiell in der Lage sind. Normal ist auch, dass es in einer solchen Konkurrenzsituation wenigstens an einigen Standorten die Befürchtung gibt, den Kürzeren zu ziehen und/oder bei der internen Auftragszuordnung benachteiligt zu werden. Trotzdem herrscht längst nicht überall, wo es Standortkonkurrenz gibt, ein derartiges Hauen und Stechen. Vielmehr gibt es meistens ordnende Strukturen und Prozesse, die dafür sorgen, dass die Auftragszuordnung vielleicht nicht konfliktlos, aber ohne Guerrillakrieg-ähnliche Auseinandersetzungen erfolgt. |
||
Die Tatsache, dass solche Guerrillakriege stattfanden, lieferte uns implizit zwei wichtige Zusatzinformationen: Erstens, dass die Beteiligten auf diese Weise einen Einfluss auf die Auftragszuordnung nehmen konnten – was ja bedeutete, dass eine übergeordnete Steuerung entweder nicht existierte oder nicht funktionierte. Und zweitens, dass diese kämpferische Form der Interessenvertretung aus Sicht der Beteiligten nötig war – was ebenfalls auf gravierende Mängel der zentralen Koordination hinwies. Denn solche Kämpfe finden ja nicht statt, weil den Beteiligten sonst so schrecklich langweilig wäre, sondern weil sie der festen Überzeugung sind, auf diese Weise ihre Standortinteressen verteidigen zu müssen, und zwar gegen Konkurrenten, die einen anderenfalls an die Wand drücken würden. So betrachtet, ist es gar nicht die Standortkonkurrenz an sich und auch nicht in erster Linie die vorausgegangene Übernahme, die zu den bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Management führte, sondern das Fehlen einer verlässlichen und verbindlichen Prozedur der Auftragszuordnung. |
||
Die Falle einer zu schnellen Sachlösung |
||
Hat man diesen Mangel erst einmal als zentrale Ursache der vorhandenen Konflikte erkannt, liegt es nahe, umgehend eine (Sach-)Lösung dafür zu suchen. So liegt es nahe, etwa den pfiffigen Assistenten der Geschäftsführung damit zu beauftragen, zusammen mit den Leitern des Controlling und der internen Planung auf der Basis der bekannten strategischen Vorgaben einen Vorschlag für eine Neuregelung der Auftragszuordnung zu entwickeln, ihren Vorschlag in der Geschäftsführung zu verabschieden und das Ergebnis bei nächster Gelegenheit den versammelten weltweiten Führungskräften vorzustellen. |
||
Deren Reaktion auf ein solches Vorgehen bestünde mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder aus einem schwer interpretierbaren, aber von spürbarer Skepsis getragenen Schweigen oder in einer vorsichtigen, ebenfalls von spürbarer Skepsis und vager Hoffnung geprägten Zustimmung: "Nun ja, die Regelung klingt ja durchaus vernünftig. Wir wollen hoffen, dass es funktioniert und dass sich die anderen auch wirklich an diese Regelung halten werden!" Was, frei ins Deutsche übersetzt, soviel heißt wie: "Wir haben erhebliche Zweifel, dass sich die anderen daran halten werden, und werden daher bis zum Beweis des Gegenteils nicht von unserem bisherigen Vorgehen abrücken." |
||
Das Problem mit Sachlösungen ist, dass sie in einem manifesten Konflikt unabhängig von ihrer inhaltlichen Qualität kaum eine Chance haben, Akzeptanz zu finden, wenn sie entweder zu früh kommen und/oder von einer Partei, deren Neutralität und/oder Sachkunde aus Sicht der Beteiligten fraglich ist. Wenn es an dieser Akzeptanz fehlt, wird die gefundene Lösung unabhängig von ihrer inhaltlichen Qualität kaum erfolgreich sein; sie könnte dann allenfalls mit einem massiven Machteinsatz durchgedrückt werden. |
||
Um das Akzeptanzproblem nachvollziehen zu können, betrachten Sie die Situation einmal aus der Sicht eines britischen oder amerikanischen Teilnehmers des Management-Workshops: Da stellt einer der Geschäftsführer eine neue Regelung vor – und natürlich wissen Sie, dass es in der Tat ständige Konflikte gibt, due Sie und Ihre Kollegen viel Zeit und Kraft kostet. Was Sie hingegen nicht wissen, wie es um die "Abrüstungsbereitschaft" der anderen Seite(n) steht und was die wirklichen Absichten sind, die hinter der neuen Regelung stehen. Sie wissen nur, dass sie vom Assistenten der Geschäftsführung und einigen anderen "Zentralisten" entwickelt wurde – womöglich unter Mitwirkung des deutschen Werksleiters, der an ihrer Entstehung schon räumlich sehr viel näher dran war als Sie und Ihre Kollegen. Sollen Sie sich da wirklich darauf vertrauen, dass die neue Regelung fair und ausbalanciert ist, und sich vorbehaltlos auf sie einlassen, oder wäre das ein schon an Dummheit grenzender Grad von Naivität? Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden Sie sich erst einmal für eine "defensive Linie" entscheiden, also abwarten und beobachten. Und ihre Kollegen würden es vermutlich ähnlich machen. |
||
Der Knackpunkt ist bei alledem das Vorgehen, nicht der Inhalt der Lösung. Zwar wird in solchen Fällen meistens über die Inhalte der vorgeschlagenen oder vorgegebenen Lösung debattiert, doch das eigentliche Problem sind nicht die Inhalte, sondern die Art, wie sie zustande gekommen sind. Zum einen stößt eine von oben vorgegebene Lösung in solch einer angespannten Situation unweigerlich auf Misstrauen; zum anderen ist es immer unklug, über eine Lösung zu reden, solange das Problem nicht klar benannt ist und kein Konsens über den Handlungsbedarf besteht. Denn solange kein Konsens über das Problem herrscht, ist es kein Wunder, wenn man sich auch nicht auf eine Lösung einigen kann. Deshalb lautet eine bewährte Regel: "Problemkonsens vor Lösungskonsens!" |
||
Einen anschlussfähigen Weg zur Sachlösung gestalten |
||
Aber wie kommt man in einer solchen Situation zu einem Problemkonsens? Die einfachste Möglichkeit ist, alle Betroffenen und Beteiligten an einen Tisch zu holen und dann einfach mal beim Namen zu nennen, wie die Situation ist. Das ist zwar für die meisten Beteiligten mit einigem Stress verbunden, weil es vielen doch schwer fällt, in Anwesenheit ihrer Kontrahenten klar und deutlich auszusprechen, was sie in deren Abwesenheit schon unzählige Male beklagt haben. Aber der Anspruch ist ja auch nicht, dass es gemütlich ist, sondern dass es überhaupt geschieht und dass dadurch die Voraussetzungen für eine Klärung geschaffen werden. Ein Management-Workshop kann dafür bei geeigneter Gestaltung durchaus ein geeignetes Forum sein. |
|
|
Zwar kann das – nach einem meist sehr vorsichtigen Beginn – eine recht temperamentvolle und emotionale Sitzung werden, wenn sie die Beteiligten gegenseitig mit Vorwürfen überhäufen und über unfaire Praktiken der jeweils anderen Seite beklagen. Aber nach einiger Zeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Überdruck raus, und es tritt eine erschöpfte Ruhe ein – und ein Stück Besinnung. Allen ist spätestens nach dieser Auseinandersetzung klar, dass sie selbst auch keine Unschuldslämmer sind und dass es einer grundlegenden Korrektur bedarf, weil es so nicht weitergehen kann. Irgendwann steht daher die Frage im Raum: "Und was machen wir jetzt?" Ab dann kann man vernünftig über mögliche Lösungen reden. |
||
In einem internationalen Kontext ist allerdings wichtig zu beachten, dass kaum etwas von Kultur zu Kultur so unterschiedlich ist wie der Umgang mit Konflikten. Während wir Deutschen, verglichen mit anderen Ländern, ausgesprochen direkt und geradeheraus sind, sind zum Beispiel Briten gewohnt, sich bei Konflikten eher indirekt und diplomatisch auszudrücken, und auch in den USA – und dort vor allem in den Küstenregionen – ist die Hemmschwelle groß, Konflikte und ihre Akteure offen beim Namen zu nennen. Selbst bei offenkundigen Differenzen neigen Amerikaner dazu, Konflikte herunterzuspielen und sie eher indirekt über Verbesserungsvorschläge anzudeuten. Sowohl britische als auch amerikanische Manager fühlen sich in der Regel äußert unwohl, wenn ein schwerwiegender Konflikt in der beschriebenen Weise offen zur Sprache gebracht wird und sie dazu Stellung nehmen sollen. |
||
Nun ist zwar nicht das höchste Ziel einer Konfliktklärung, dass sich die Beteiligten dabei wohl fühlen; es muss aber unbedingt vermieden werden, dass sich die angelsächsische Seite von dem "teutonic rigor" überrollt und an die Wand gedrückt fühlt. Denn wenn sie mit dem Gefühl nach Hause fährt, dass ihr die gefundene Einigung mit unfairen Mitteln abgepresst wurde, wird sie sich daran kaum gebunden fühlen, und dementsprechend wenig wäre das Ergebnis wert. Es muss also ein Vorgehen gefunden werden, das sich nicht einseitig an den Kulturstandards der einen Seite ausrichtet, sondern allen Seiten einigermaßen gerecht wird. Und zwar ohne dass die Differenzen und Interessenkonflikte dabei unter den Teppich gekehrt werden – denn wenn sie jetzt nicht ausgeräumt werden, dann wirken sie weiter. Das heißt nicht notwendigerweise, dass alles ausgesprochen werden muss, aber es heißt, dass ein belastbarer Konsens gefunden werden muss. |
||
|
||
Die Weichen von Anfang an richtig stellen |
||
Vom Grundsatz her war der geplante Management-Workshop ein geeignetes Forum, um den Konflikt auf den Tisch zu bringen und an einer Lösung zu arbeiten. Wenn dies jedoch ohne ausreichende Vorbereitung geschehen würde, würde es die Briten und Amerikaner höchst wahrscheinlich, wie beschrieben, in die Defensive zu drängen und damit eine Situation zu schaffen, die von ihnen als unfair empfunden würde. Zugleich würden sich wenigstens einige der Deutschen wegen der Sprachbarriere ebenfalls im Nachteil fühlen, was bei einer so wichtigen Angelegenheit die Gefahr mit sich brächte, dass sie sich besonders vehement und aggressiv zu Wort melden. Dann jedoch könnte die Sache aus dem Ruder laufen: Wenn beide (bzw. alle) Seiten Angst haben, dass ihre Interessen und Bedürfnisse unter die Räder kommen, würden sie vermutlich ziemlich empathiefrei für ihre Vorstellungen kämpfen – und sich auf diese Weise möglicherweise noch tiefer zerstreiten. |
||
Um der Diskussion eine bessere Ausgangsbasis zu verschaffen, entschlossen wir uns daher, im Vorfeld Interviews mit allen Teilnehmern zu führen, um sie zu ihrer Sichtweise und möglichen Lösungsperspektiven zu befragen. Das war angesichts des internationalen Teilnehmerkreises nicht ganz einfach zu organisieren, aber es schien den Aufwand wert. Denn Vorgespräche sorgen in aller Regel für eine gewisse Entlastung und eine Entkrampfung der Situation, weil die Teilnehmer den oder die Moderatoren im Vorfeld des Workshops schon einmal kennenlernen und die Gelegenheit haben, ihm in einer entspannten und wertschätzenden Atmosphäre ihre Sicht der Dinge zu schildern. Sie müssen dann nicht mehr mit höchster Anspannung und Wachsamkeit in den Workshop gehen, voller Misstrauen und Sorge, dass sie dort vielleicht untergebuttert werden sollen und ob sie überhaupt Gelegenheit haben werden, ihre Perspektive ausreichend darzustellen und ihre Interessen zu vertreten. |
|
|
Die Ergebnisse der Interviews sollten, so wurde allen Teilnehmern mitgeteilt, von den Moderatoren zu Beginn des Workshops vorgestellt werden, um ohne lange Vorarbeit einen Startpunkt für die Diskussion zu haben. Dies sollte beiden Seiten helfen: Den Briten und Amerikanern sollte es die Qual ersparen, den Konflikt mit der nötigen Klarheit auf den Tisch bringen zu müssen; den Deutschen sollte es die Sorge abnehmen, ob es ihnen trotz der vorhandenen Sprachbarriere gelingen würde, ihre Sicht der Dinge ausreichend klar und nachvollziehbar darzustellen. Die ausgewogene Darstellung aller Sichtweisen und die klare Benennung des vorhandenen Interessenkonflikts durch die Moderatoren sorgten dann auch gleich zu Beginn für Erleichterung bei allen Beteiligten: Zwar war der Konflikt nun auf dem Tisch, und man konnte ihm nicht mehr ausweichen, doch es war gelungen, ihn auf eine Art und Weise darzustellen, die alle als im Wesentlichen zutreffend empfanden und bei der niemand als "der Böse" dargestellt sah. Also musste sich auch niemand rechtfertigen, verteidigen oder sich mit Gegenangriffen Entlastung verschaffen. |
||
An die Emotionen herankommen |
||
Dennoch waren die Moderatoren bei ihrer Vorbereitung zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh wäre, in eine Diskussion über Lösungen einzusteigen: Zwar war der Konflikt und die durch ihn ausgelösten Emotionen jetzt klar benannt, bislang aber nur stellvertretend durch die Moderatoren. Die versammelten Manager waren dabei in der komfortablen Position, den Moderatoren nur anerkennend zuzunicken, aber nicht selber Farbe bekennen zu müssen. Es wäre daher gut, wenn diese Emotionen noch etwas mehr herauskämen – nicht aus therapeutischen Gründen oder zur Verhinderung von Magengeschwüren, sondern weil unausgesprochener Groll immer das Risiko birgt, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt nach oben zu poppen und den Arbeitsprozess in Schwierigkeiten zu bringen – vor allem wenn er nicht offen artikuliert wird, sondern sich durch subtile "Bestrafungen" der Gegenseite äußert. Was die Gefahr einer negativen Kettenreaktion in sich trägt, vor allem wenn andere Beteiligten ebenfalls noch unverziehenen Groll gegenüber denjenigen empfinden, die sich nun unkooperativ verhalten. |
|
|
Allerdings ist es keine einfache Sache, deutsche oder angelsächsische Manager dazu zu veranlassen, ihre Emotionen offen zu äußern – sie haben sich das schließlich über Jahre hinweg abtrainiert und gelernt, alle Probleme "emotionslos und sachlich" anzugehen (oder wenigstens so zu tun). Andererseits verschwinden Emotionen nicht, nur weil man sie entschlossen ignoriert, sie äußern sich dann nur auf andere, indirekte Weise, etwa durch destruktive Bemerkungen und unkooperatives Handeln. Eine direkte Frage nach den Gefühlen ist in Management-Meetings indes zwecklos; sie führt im besten Fall zu einer lauwarm-ungeduldigen Bestätigung: "Klar haben wir uns darüber geärgert, das ist doch klar, darüber brauchen wir doch nicht lange zu reden!" |
||
Um trotzdem wenigsten indirekt an die Emotionen heranzukommen, baten wir die Manager, die Auswirkungen des Dauerkonflikts auf ihre jeweiligen Standorte zu schildern – mit der Begründung, dass jeder nur sieht, was die Auswirkungen für den eigenen Standort sind, dessen Auswirkungen auf die anderen aber nicht sieht. Nach einem etwas zögernden Beginn waren wir damit schnell mitten in den Emotionen, wobei der Fokus auf den eigenen Standort den positiven Nebeneffekt hatte, dass nicht Anklagen, Vorwürfe und Beschuldigungen im Vordergrund standen, sondern nachvollziehbare Schilderungen der Schwierigkeiten und betriebswirtschaftlichen wie emotionalen Kosten, die sich die Beteiligten auf diese Weise gegenseitig eingebrockt hatten. Kleinere Ausfälligkeiten wie die Bemerkung "Because you stole us that order, …" ließen eher die Moderatoren zusammenzucken als die Teilnehmer; sie führten nicht zu einer Eskalation und, soweit erkennbar, nicht einmal zu größeren Verstimmungen. |
||
Und während am Anfang unterschwellig durchaus eine klammheimliche Schadenfreude zu verspüren war, dass, wie es ein Manager in der Pause ausdrückte, "die anderen auch gelitten hatten", setzte sich im weiteren Verlauf zunehmend das Bewusstsein durch, dass das kaum die optimale Art sein könne, eine Firma zu managen. Je länger dieser Part fortschritt, desto mehr überrascht und bestürzt waren die Teilnehmer über die Verschwendung an Geld und Energie. Und die Geschäftsführung fiel aus allen Wolken, was sich weit unter ihren Augen tatsächlich abgespielt hatte. Bis einer die Stimmung schließlich auf den Punkt brachte: "Wenn wir es schaffen, auch nur zwei Drittel dieser Energie auf den Markt zu lenken, sollten wir dazu in der Lage sein, so viel zusätzliches Geschäft zu generieren, dass alle Standorte voll ausgelastet sind!" |
||
Gemeinsamer Wille zur Lösung des Sachproblems |
||
|
Damit war der Workshop emotional über den Berg, und der Rest war im Wesentlichen "Fleißarbeit". Denn nun hatten die Teilnehmer erkannt, dass sie ein gemeinsames Problem hatten, und waren willens, es gemeinsam zu lösen. Trotzdem war es nicht einfach, zu einer Regelung zu kommen, die erstens klar, zweitens sinnvoll und drittens transparent war. Die Moderatoren hatten vielmehr noch einmal zu kämpfen, als sie darauf drängten, sich nicht mit der wechselseitigen Beteuerung guter Absichten zufrieden zu geben, auch wenn die zum jetzigen Zeitpunkt sehr wohl vorherrschend waren, sondern eine möglichst konkrete, überprüfbare Regelung festzulegen. Den Teilnehmern leuchtete aber ein, dass vage Absichtserklärungen dem Druck der Realität kaum stand gehalten hätten, wenn sie erst wieder zurück an ihren Standorten wären und von ihren Mitarbeitern und Betriebsräten bestürmt würden, für ausreichende Auslastung zu sorgen. |
|
|
Ein hartes Stück Arbeit war schließlich auch noch, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass ihr Prinzip der Standort-Spezialisierung, auch wenn es vom Grundsatz her sinnvoll war, nicht das alleinige Maß aller Dinge sein konnte. Nicht nur die Verstetigung der Auslastung der einzelnen Standorte sprach dafür, dies nicht zum einzigen Kriterium zu machen, sondern auch die Nähe zu den Kunden bei Nicht-Standardmaschinen. Denn wenn des Öfteren Absprachen mit Kunden erforderlich waren, war es ein Handicap, wenn sie auf der anderen Seite des Atlantiks gefertigt wurden, noch dazu möglicherweise in einer Fabrik, die auf ein anderes metrisches System "geeicht" war. Wie sich dabei herausstellte, war diese Diskussion vorher nie offen geführt worden – vermutlich weil die Geschäftsführung die Standort-Spezialisierung bei ihrer Einführung für "nicht verhandelbar" erklärt hatte. |
||
|
Ein heikles Thema, das auch atmosphärisch im völlig falschen Moment kam, war die von den Moderatoren aufgeworfene Frage nach Mechanismen, die im Falle eines Rückfalls greifen sollten. Diese Frage passte überhaupt nicht in die inzwischen sehr sachliche und versöhnliche Stimmung, doch die Teilnehmer akzeptierten widerwillig, dass der Punkt nicht an den Haaren herbeigezogen war. Im Gegenteil: Angesichts der belasteten Vorgeschichte wäre es im Grunde ein Wunder, wenn alles auf Anhieb reibungslos funktionieren würde. Zu zahlreich waren die schlechten Erfahrungen, und zu groß wäre spätestens in ein paar Wochen wohl auch das Misstrauen gewesen, dass "die anderen" sich vielleicht doch nicht an die Regelungen hielten und versuchten, die Gutgläubigkeit des eigenen Standorts auszunutzen. |
|
|
|
Also wurde eine Regelung verabredet, die aus drei Elementen bestand. Erstens aus maximaler Transparenz: Jeder Standort erhielt das Recht, sich im Detail über die Aufträge der anderen Standorte und die Gründe ihrer Zuordnung zu informieren, notfalls auch vor Ort. Zweitens aus einer Schiedsinstanz, nämlich der Geschäftsführung: Im Konfliktfall würde sie entscheiden, ob ein Auftrag mit unfairen Mitteln an Land gezogen wurde. Und drittens aus einer "geordneten Vergeltung": Gemäß dem spieltheoretischen Prinzip "Tit for tat" sollte der unfair benachteiligte Standort das Recht haben, sich von den nächsten neuen Aufträgen einen auszusuchen, der eigentlich dem Standort zugestanden hätte, welcher sich "vorgedrängt" hatte. Und zwar ausdrücklich auch dann, wenn dieser Auftrag attraktiver wäre und ein höheres Fertigungsvolumen umfasste. |
|
|
|
Nun ist eine Konfliktregelung nicht dann erfolgreich, wenn alle mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, sondern erst, wenn sich die gefundene Lösung in der Praxis bewährt. Das muss zeitnah überprüft werden, damit bei Problemen rechtzeitig gegengesteuert werden kann und sich nicht neue Frustration aufbaut. Deshalb wurde verabredet, den turnusmäßigen Folge-Workshop nicht erst in einem Jahr durchzuführen, sondern schon in acht Monaten, und dort die erreichten Verbesserungen und den eventuellen Bedarf für Nachkorrekturen zu bewerten. Dieser Workshop wurde dann allerdings verschoben, weil sich in der Zwischenzeit herausgestellt hatte, dass zwar die "Stufe 1" der besagten Regelung einige Male zum Einsatz gekommen war und auch zwei Vor-Ort-Besuche stattgefunden hatten, dass aber weder die Anrufung der Geschäftsführung noch die "geordnete Vergeltung" jemals zum Einsatz gekommen waren. Da es kein wirkliches Problem mehr gab, meinten die Standortmanager übereinstimmend, müssten sie sich auch nicht unbedingt vorzeitig treffen, um es zu lösen. Das reguläre Treffen ein Jahr später fand in gelöster, beinahe freundschaftlicher Stimmung statt: Offensichtlich hatte das gemeinsam bewältigte Problem "nebenbei" auch die kulturelle Integration deutlich vorangebracht. |
|
|
|
|
|
||
|